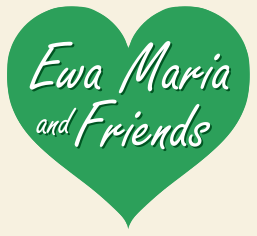MONIKA WRZOSEK-MÜLLER – LESUNG & GESPRÄCH
April 28, 2024
[DEU] | [POL]
[DEU]
SprachCafé Polnisch, Schulzestr. 1, 13187 Berlin
17. Mai 24, 19:00 Uhr
Es liest und spricht mit den Gästen Monika Wrzosek-Müller
Autorin vom ewamaria.blog
Es laden ein und den Abend moderieren Ewa Maria Slaska, Ela Kargol
Monika schrieb dazu:
Geschrieben habe ich eigentlich immer, interessanterweise öfter und intensiver auf Deutsch als auf Polnisch. Das hat vielleicht mit meinem Germanistik-Studium zu tun, oder aber doch mit der eher präzisen und ordnenden deutschen Sprache; sie zwingt mich, dem Wust meiner Gedanken einen verständlichen Rahmen zu geben. Und natürlich, ich lebe ja in Deutschland.
Dass ich nicht mehr zu den Junioren gehöre, hat mir gerade wieder eine Einladung vor Augen geführt, die ich vor ein paar Tagen bekommen habe: „Aus Anlass unseres 50. Abitur-Jubiläums laden wir euch alle am 17.05 um 16.30 Uhr in die Bar Lolek in Warschau ein.“ Wenn man dann noch die Kinderjahre dazu zählt, kommt eine stattliche Zahl von Lebensjahren heraus.
Ich schreibe immer aus einem konkreten Anlass. Es sind viele kurze Beiträge. Ja, ich habe nachgezählt; es sind wirklich gut über 110 Einträge. Ich würde mich gerne – ich gebe es zu – auch an einem etwas längeren Format versuchen und bei einem Thema bleiben, aber es fehlt mir an Mut, an Muße und an Geduld.
Ewa war mir immer eine große Unterstützerin, Begleiterin und (in positivem Sinn) Antreiberin. Vielen Dank dafür.
Das Treffen findet hauptsächlich in der deutschen Sprache statt.
Eintritt frei, Spenden für Sprachcafé Polnisch – willkommen.
Die Veranstaltung findet statt im Rahmen des Projektes „In der Schulze“ mit Unterstützung des Bezirksamtes Pankow.
Foto © Michael G. Müller

[POL]
SprachCafé Polnisch, Schulzestr. 1, 13187 Berlin
17 maja 2024 o godzinie 19:00
Z gośćmi rozmawia i i teksty z bloga – ewamaria.blog – czyta Monika Wrzosek-Müller
Zapraszają i wieczór prowadzą Ewa Maria Slaska i Ela Kargol
Monika napisała:
Właściwie piszę od zawsze, co ciekawe częściej i intensywniej po niemiecku niż po polsku. Być może wiąże się to z faktem, że studiowałam germanistykę, a może z tym, że język niemiecki jest precyzyjny i uporządkowany, co sprawia, że mogę ująć to, co myślę w uporządkowane ramy. No i oczywiście mieszkam w Niemczech.
Kilka dni temu przyszło zaproszenie, które niestety przypomniało mi, że nie jestem już juniorką. „Z okazji 50-lecia matury zapraszamy wszystkich do Baru Lolek w Warszawie…“ A przecież były jeszcze lata, które przeżyłam jako dziecko – imponująca liczba lat!
Zawsze piszę z konkretnego powodu. Wiele, z reguły dość krótkich tekstów. Tak, policzyłam – grubo ponad 100 wpisów. I mnóstwo tematów. Chciałbym – przyznaję – spróbować sił w nieco dłuższym formacie i trzymać się jednego tematu, ale brakuje mi odwagi, wolnego czasu i cierpliwości.
Ewa zawsze była dla mnie wielkim wsparciem, towarzyszką, motywatorką. Wielkie dzięki.
Spotkanie (głównie) po niemiecku.
Wstęp wolny, datki dla Sprachcafé Polnisch – mile widziane.
Spotkanie realizowne jest w ramach projektu „Na Schulze” przy wsparciu Urzędu Dzielnicowego Pankow.